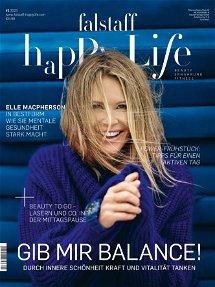Sauna vs Infrarotkabine: Alles nur heiße Luft?
Es fühlt sich gleich an: heiß. Es löst dieselbe Reaktion aus: Schwitzen. Es sieht ähnlich aus: Holzkabine. Es wirkt ident: erholsam. Und doch sind es zwei völlig unterschiedliche Systeme: Sauna und Infrarotkabine. Beides erfüllt denselben Zweck, nur eben anders.
05.01.2024 - By Klaus Höfler
Das beginnt schon beim Wesentlichen, nämlich der Art der Hitze. Heiße Luft ist nämlich nicht gleich heiße Luft. In der klassischen Sauna sitzt man bei einer Temperatur von 80 bis 95 Grad und transpiriert vor sich hin. Die Wärme gelangt über die aufgeheizte Luft an und in den Körper. Die Gefäße weiten sich, die Durchblutung wird gefördert und man fängt binnen kürzester Zeit an zu schwitzen. In einer Infrarotkabine hat das Schwitzen dagegen eine andere Ursache. Man schwitzt »von innen heraus«. Die Wärme wird nicht über die Luft übertragen, sondern über die namensgebenden Infrarotstrahlen. Sie erzeugen zwar eine wohlige Wärme in der Kabine, es bleibt aber deutlich »kühler« als in einer Saunakabine. Die Strahlen werden erst beim Kontakt mit dem Körper in Wärme umgewandelt. Dort gehen sie im wahrsten Sinne des Wortes »unter die Haut«, dringen nämlich bis zu vier Millimeter ins Unterhautgewebe ein. Diesen Effekt nimmt man als (Tiefen-)Wärme wahr – und beginnt zu schwitzen. Es ist ein Schwitzen, das jenem beim Sport sehr ähnlich ist. Die Gewebetemperatur erhöht sich, was zu einer Gefäßerweiterung führt. Der Blutdruck sinkt. Die intensive Wärme kurbelt die Blutzirkulation an und sorgt für eine verbesserte Sauerstoffzufuhr. Die Muskeln lockern sich, Verspannungen lösen sich, die Durchblutung wird angeregt und durch die Schweißproduktion werden Gift- und Schadstoffe aus dem Körper ausgespült. Auch Milchsäure, die nach intensiven Trainingseinheiten zur Übersäuerung der Muskeln führt, wird abgebaut. Eine entspannende Wirkung stellt sich ein – das gilt aber für beide »Schwitzkammerln«.
In der klassischen Sauna stellt sich ein gesundheitsfördernder Effekt ein, weil der Wechsel von heiß zu kalt den Kreislauf anregt. Auch das Hautbild verbessert sich. Trockene Hautstellen nehmen Feuchtigkeit auf. In Infrarotkabinen kann man gezielter beispielsweise auf das Lindern von Gelenkreizungen oder das Eindämmen entzündliche Prozesse im Körper abzielen. Dafür muss man aber wissen, zu welcher Variante der Hightech-Heizstrahler man greift. Grundsätzlich wird Infrarotstrahlung in die Bereiche A, B und C unterteilt. Sie unterscheiden sich durch die Wellenlänge und Eindringtiefe der Strahlung. Im häuslichen Gebrauch kommen B- und C-Strahlen zum Einsatz. Man unterscheidet diesbezüglich einerseits zwischen Flächenstrahlern, die eine behagliche Wärme zwischen 45 und 60 Grad erzeugen, und bei denen man sich hinlegen oder sogar an die Strahlerplatten anlehnen kann. Geschwitzt wird hier nur wenig. Keramik- oder Vollspektrumstrahler dagegen sind »Punktstrahler«, die man nicht berühren darf. Die korrekte Sitzposition direkt vor den Strahlern ist daher wichtig. Verspannungen und Verkrampfungen lösen sich nämlich nur, wenn die Infrarotstrahlen optimal auf die Haut treffen und in diese eindringen können. So wird eine punktuelle Wirkung mit deutlich spürbarer Wärmeentwicklung erzielt – man beginnt zu schwitzen. Es gibt aber auch Kombi-Installationen – also Heizsysteme, die die Vorteile von Flächen- und Keramikstrahler kombinieren – sowie Systeme, in denen alle drei Strahlertypen verbaut sind.
Unterschiede zur Sauna bestehen auch beim Energieverbrauch. Er ist in einer Infrarotkabine durch den kürzeren Aufheizbedarf und die kürzere Besuchsdauer deutlich geringer. Denn einerseits kann man sich täglich in die Infrarotkabine setzen, sollte aber nur zwei bis drei Mal pro Woche eine Sauna besuchen. Zudem dauert das klassische »Saunieren« deutlich länger. Denn in die Sauna geht man für zwei bis drei Aufgüsse pro Session, wo die Luftfeuchtigkeit dann für kurze Zeit rapide erhöht wird. In eine Infrarotkabine setzt man sich dagegen nur für einen – dafür etwas längeren – Durchgang bei stabil trockener Luft. Gefährlich – und zwar für den Kreislauf – wird es in beiden Fällen nur, wenn man zu lange in den Kabinen bleibt. Und dann gibt es noch eine Zwittervariante: Sieht aus wie eine Sauna, ist aber nur so warm wie ein Infrarotkabine: Bio- oder Niedrigtemperatursaunen kommen auf rund 50 Grad, die Verweildauer ist dafür bis zu doppelt so lange (40 Minuten) wie in einer klassischen finnischen Sauna. Also was jetzt: Sauna oder Infrarotkabine? »Das kommt darauf an«, möchte man typisch österreichisch antworten. Mehr Charme hat jedenfalls die Geschichte der klassischen – finnischen – Sauna, die es bereits vor 10.000 Jahren gegeben haben soll, als Erdlöcher, mit Tierfellen abgedeckt, als Schwitzkammern genutzt wurden. Überraschenderes findet sich dagegen in der Historie der Infrarotkabinen. Die erste wurde bereits 1891 gebaut – von Harvey Kellogg. Bekannter wurde der mit zwei weiteren Erfindungen, die ihm zugeschrieben werden: der Erdnussbutter und den Cornflakes.