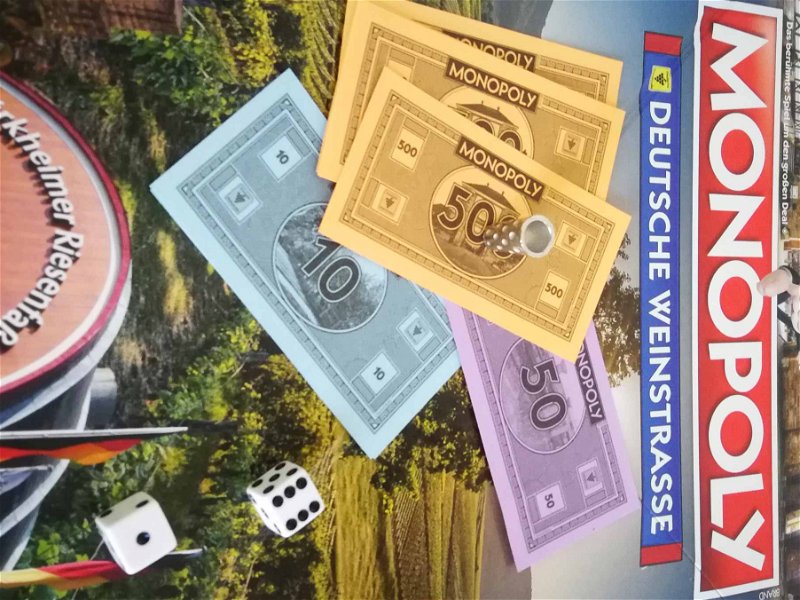Grauburgunder: Pfälzer Barock
Pinot Grigio war gestern: Deutscher Grauburgunder boomt. Jetzt avanciert der üppige Weiße sogar zum
Steckenpferd der Pfälzer.
Florian Werner vom Weingut Münzberg versenkt den Probenheber im Spund eines Stückfasses und holt ihn gefüllt wieder zurück ans Licht. Hellgolden fließt der Wein ins Glas. Schaut man genau hin, lässt sich auch ein kupferfarbener Schimmer ausmachen. »Schneckenberg Grauburgunder, Jahrgang 2017, noch auf der Hefe.« Der Jahrgangsvorgänger desselben Weins hatte am Vormittag desselben Tages die Falstaff-Blindprobe für sich entschieden: »konzentriert stoffig«, so der Kommentar der Jury, »aromatisch«, »packend«, »lang«. Der 2017er schmeckt genauso gut und zaubert ein Lächeln auf die Gesichter der Anwesenden: »Die Burgundersorten sind unsere Kompetenz hier beim Weingut Münzberg«, fügt Außenbetriebsleiter Nico Keßler an. »Die passen einfach zu unseren schweren Kalkböden. Doch der Grauburgunder war früher immer etwas der Exot, weil er mit Restsüße ausgebaut wurde. Erst vor ein paar Jahren haben wir einen Schnitt gemacht und bauen ihn jetzt als richtigen Burgunder aus, trocken und im Fass.«
Dass der Grauburgunder seine Karriere dem Zeitalter des Barock verdankt, kann man als Fingerzeig nehmen: Noch die »Ruländer« der 1970er-Jahre waren pausbäckige Putten.
Dieser Imagewandel ist typisch für den Grauburgunder – kaum eine Sorte ging in den letzten 25 Jahren durch so viele Phasen stilistischer Entwicklung hindurch. In den 70er-Jahren wurde die bronzefarbene Spielart der Burgunderfamilie noch als »Ruländer« bezeichnet – nach dem Pfälzer Kaufmann Johann Seger Ruland (1683–1745) aus Speyer, der diese natürliche Mutation des Spätburgunders als Erster systematisch genutzt haben soll. Dass die Sorte den Beginn ihrer Karriere dem Zeitalter des Barock verdankt, kann man dabei getrost als Fingerzeig nehmen. Noch die Ruländer der 1970er-Jahre waren barocke Weine, pausbäckige Putten im Weißwein-Kosmos der deutschen Winzer, die damals noch in erster Linie gegen das Vorurteil zu kämpfen hatten, ihre Weine seien zu leicht und zu sauer.

Imagewandel einer Sorte
»Mein Vater hätte mich fast vom Hof gejagt, als ich um das Jahr 1980 herum zum ersten Mal eine trockene Ruländer-Spätlese ausgebaut habe«, erinnert sich Theo Minges aus Flemlingen, dessen Grauburgunder »vom Muschelkalk« heute zu den stilsichersten der Pfalz gehört. Der Konflikt, den Minges erlebte, war recht typisch für die damalige Zeit: Die ältere Generation befürchtete, dass vom Ruländer nicht viel übrig bleiben würde, wenn man ihm seine üppige Süße und seine Botrytisfrucht wegnähme. In der Tat bestätigten viele simple Pinot-Grigio-Weine aus Norditalien mit ihrer neutralen Art genau diese Befürchtungen. Dennoch war der Siegeszug des süffigen, unkomplizierten Weintyps nicht aufzuhalten: Da uns Deutschen zudem der Name »Pinnogridscho« recht leicht von der Zunge geht, wurde alles zum Kassenschlager, was diese Bezeichnung auf dem Etikett trug. Auch die einheimischen Winzer folgten dem Trend – zuerst mit der wörtlichen Übersetzung »Grauburgunder«. Und fast zeitgleich mit Weinen, die den erwünschten trockenen Geschmack zeigten, oft aber ebensowenig Kontur und Inhalt hatten wie die (negativen) Vorbilder aus Norditalien.

Obacht – Billigheimer
Dabei liegt in der DNA des Grauburgunders eher das Rundliche, das Kräftige: Er wirkt zuweilen wie ein sehr reif gelesener Spätburgunder, dem die Natur die Gerbstoffe versagt, dafür aber eine Extraportion Fett auf die Rippen gelegt hat. Will man diesem Wein das Aussehen eines Asketen geben, muss man zuerst die Erträge im Weinberg hochfahren. »Wir sollten achtgeben, dass der Grauburgunder nicht denselben Weg nimmt wie der Dornfelder«, mahnt daher Martin Bauer vom Weingut Emil Bauer, dessen eigene Grauburgunder zu den wuchtigen, stoffigen Vertretern der Sorte gehören. Bauers Mahnung hat einen ernsten Hintergrund: Denn wie es beim Dornfelder um das Jahr 2000 herum der Fall war, so schossen in den letzten zwei, drei Jahren auch beim Grauburgunder die Faßweinpreise durch die Decke. Ein Liter rebsortenreiner, aber ansonsten namenloser Grauburgunder kostet momentan am Fassweinmarkt nahezu doppelt so viel wie ein vergleichbarer Liter Riesling: nämlich 1,50 Euro und mehr. Gekauft werden solche Partien überwiegend von großen Kellereien, die mit diesen Weinen Marken-Grauburgunder fürs Supermarktregal abfüllen.
Erzeugt wiederum werden die Fassweine vor allem von Winzern, die den schnellen Euro suchen. Hoher Literpreis plus hoher Hektarertrag, das weckt natürlich Begehrlichkeiten: Zwischen 2012 und 2016 wuchs die Grauburgunderfläche bundesweit um 1137 Hektar und damit um mehr als 20 Prozent. Beim Dornfelder folgte dem Boom ein Crash der Fasswein-Notierungen – und zudem, schlimmer noch, ein Prestigeverlust, der sich wohl nicht mehr zurückdrehen lässt.

Ein Schritt zurück, zwei nach vorn
Die Popularität des Grauburgunders habe aber doch auch ihr Gutes, gibt Winzerin Tina Pfaffmann zu bedenken: »Denn er ist genau das Richtige für Kunden, die dem Riesling wegen seiner Säure mit Skepsis gegenüberstehen.« Ihr eigener, wegen geräumter Lager schon früh abgefüllter 2017er zeigte dann auch, dass »populär« und »vielschichtig« keine Gegensätze sein müssen.

Prinzipiell legte die Falstaff-Blindprobe nahe, dass die Suche der Winzer nach neuen, hochwertigen Grauburgunder-Stilen in vollem Gange ist. Dabei gehört die Betonung von Süße und honigartigen Botrytis-Aromen der Vergangenheit an. Doch auch das Trimmen der Sorte auf schlanke Süffigkeit ist -passé. Die Winzer lassen dem Grauburgunder jetzt wieder seine Fülle, flankieren sie aber mit Zug und Frische. Selbst wo der alte Typ Ruländer mit einer Nuance von Hoch- bis Überreifefrucht anklingt – etwa beim raffinierten Wein des Weinguts Fader, dem Ertrag eines 50-jährigen Weinbergs –, bleiben Saftigkeit und Eleganz gewahrt. Und die Sorte reizt zum Spielen: Die Winzer setzen verschiedene Fassgrößen ein, nützen den Hefeausbau, dosieren ein paar Gramm Restsüße oder lassen den Wein völlig trocken. Friedrich Becker, der Rotwein-König unter den Pfälzer Winzern, vergärt den Grauburgunder sogar auf der Schale – und erhält dank der roten Farbpigmente in der bronzefarbenen Beerenhaut eine Art Rosé.

Beeindruckt von den Weinen der Pfälzer Kollegen war dann auch der badische Winzer Markus Wöhrle, der die Falstaff-Jury verstärkte. Er hätte sich einzig hier und da noch mehr Mut gewünscht, das Burgunderhafte und die Struktur zu betonen, so Wöhrle. Nach der Auflösung der Blindprobe stellte sich heraus, dass seine Favoriten die Réserve-Weine von Philipp Kuhn waren. »Solches Lob von den Badenern – das geht natürlich runter wie Öl«, freute sich Kuhn auf die entsprechende Mitteilung. Um die Struktur betonen zu können, so Kuhn weiter, benötige man aber auch die richtigen Böden. »Meine Réserven wachsen in Dirmstein. Da ist viel Kalk und Löss. Die Böden sind so hell, im Sommer braucht man glatt eine Sonnenbrille. Man denkt, man ist auf den Malediven am Sandstrand. Aber wenn beim Grauburgunder Lehm im Spiel ist, dann wird’s gefährlich, dann bekommt man diese Panzer.«

Ein kulinarischer Tausendsassa
Last, but not least, wie sieht es aus mit der kulinarischen Ader des Grauburgunders? »Durch seine cremige Art ist er enorm vielseitig. Dickere Saucen, Schärfe – all das setzt ihn richtig in Szene«, so Philipp Kuhn. Geradezu ein Plädoyer hält Anne-Sophie Stern, die Ehefrau des Winzers Dominik Stern: »Pastagerichte, Salate, Fleisch – wir hatten Grauburgunder auch schon in Verbindung mit asiatischen Gerichten, Jakobsmuschel, Curry. Die Frage ist doch nur: Kann ich mich freimachen von Konventionen? Und mal einen Grauburgunder ausprobieren?« Eine Frage, der nichts hinzuzufügen ist.