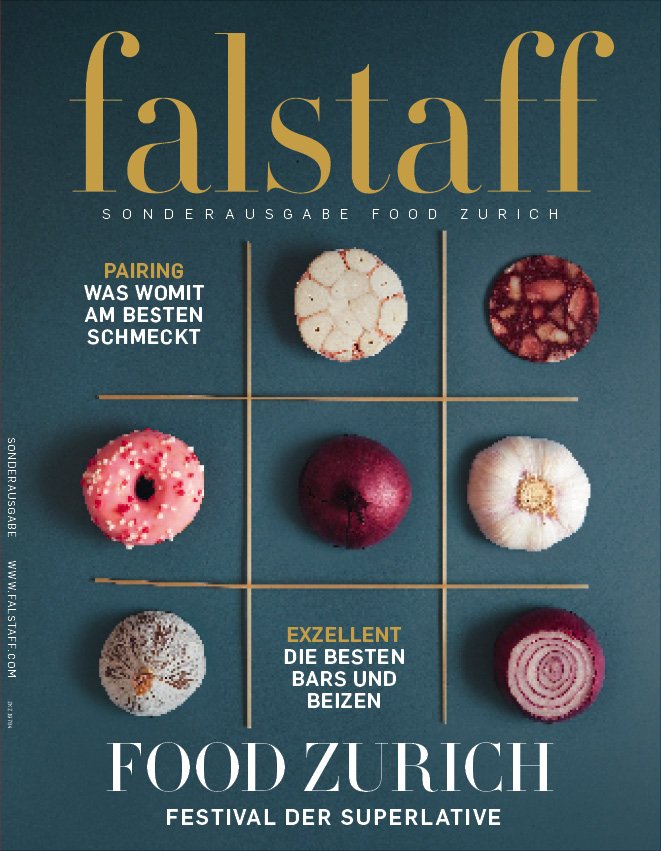Die Krone des Geschnetzelten
Das Zürcher Geschnetzelte gilt vielen als Schweizer Nationalgericht. Wir liessen uns in der «Kronenhalle» zeigen, wie einfach man diese geniale, traditionelle Speise zubereiten kann.
Die Anreise erfolgt von Köln aus im Speisewagen der Schweizer Bahn, den das Cateringunternehmen Elvetino betreibt. Der Schweizer Speisewagen ist nicht nur in Sachen Design – wie vieles in der Schweiz – erste Klasse, sondern bietet auch hochwertige Fertiggerichte. Freilich: Das ist kein echter Speisewagen mehr, wie ihn in Europa nur mehr die Bahnen der Randländer Tschechien, Polen, Ungarn, Spanien und Portugal betreiben, sondern lediglich ein Waggon mit Aufwärmöfen. Trotzdem schmeckt das, was auf die Teller kommt, obwohl es Tage vorher in Zürich abgepackt wurde. Man merkt: In der Schweiz sind alle Grundprodukte der Gastronomie – schon wegen der aufrufbaren Preise – etwas höherwertiger als im Rest Europas. Selbstredend steht in diesem Speisewagen auch das Zürcher Geschnetzelte auf der Karte. Und mit einer guten Flasche Chasselas – als Begleiter der dünn geschnittenen Kalbfleischstücke in Pilzrahmsauce mit Kartoffelrösti – rollt man schnell und zufrieden über die alte Rheingau-Baden-Strecke nach Basel und weiter nach Zürich.
Wir sind nach Zürich gekommen, um in der alten und ehrwürdigen Restaurantinstitution «Kronenhalle» nachzuforschen, wie so ein Geschnetzeltes eigentlich entsteht – an jenem Ort also, an dem es in Zürich täglich wohl am meisten von Gästen aufgerufen wird. Dazu wird uns zur «Betreuung» Souschef Philippe Schoch beigestellt, ein grundsympathischer Kerl, der breitestes Schwyzerdütsch spricht, vor der «Kronenhalle» in einigen der besten Häuser der Schweiz und des umgebenden Auslands arbeitete und hier, vor Eintreffen des eigentlichen Küchenchefs, den Laden managt und auch darauf schaut, dass wir nirgendwo im Wege stehen.
Des Zürchers Schnitzel
Das Zürcher oder Züri (und nicht Züricher) «Gschnätzlets» gilt den Menschen ausserhalb der deutschsprachigen Schweiz als Schweizer Nationalgericht. Innerhalb der deutschsprachigen Schweiz jedoch ist es nur eines der vielen Regionalgerichte, denn nur wenige Kilometer westwärts beispielsweise regiert schon die St. Galler Kalbsbratwurst das gaumenpopulistisch Heimatliche; wiewohl es Bratwurst, Geschnetzeltem und Eglifilet ähnlich ergeht wie dem Wiener Schnitzel und dem Rheinischen Sauerbraten: Die autochthonen Einwohner essen diese Gerichte eher selten. Man muss heute lange nach einem Schwaben suchen, der sich mehr als einmal im Monat Maultaschen zubereitet.
Zudem: Das Zürcher Geschnetzelte ist kein altes, tradiertes Gericht, das schon vor hundert und mehr Jahren in Rezeptbüchern und auf Speisekarten stand, sondern der Entwurf eines unbekannt gebliebenen Schweizer Kochs, dem knapp nach Ende des Zweiten Weltkriegs bei einem Sportfest die Kalbssteaks ausgingen. So – so will es die Legende, die auch von der Geschäftsführung der «Kronenhalle» erzählt wird – bastelte er aus den verbliebenen Resten – und aus Kartoffeln, Champignons, Rüebli und Rahm – eine Mahlzeit, die das zur Neige gehende Kalbfleisch «streckte» und alle Anwesenden satt machte. Das ist freilich nur eine von einem halben Dutzend Geschichten, woher das Geschnetzelte eigentlich kommt und wer es kreierte. Aber es ist jene Geschichte, die sich am vergnüglichsten erzählen lässt.
Es gibt mannigfaltige Varianten des Geschnetzelten, denn dieses stand nie – wie etwa das Wiener Schnitzel – unter Beobachtung eines kaiserlichen Hofes, der strikt auf die Einhaltung der Zutaten und der Zubereitungsweise bestand. Dem «echten Wiener Schnitzel», das man in Wien am authentischsten noch im «Hotel Sacher» oder beim «Figlmüller» bekommt, war das Kalbfleisch und die Panier (Mehl, Eier, Semmelbrösel) sowie das Frittieren in zwei bis drei Pfannen immer vorgeschrieben; dem Zürcher Geschnetzelten hingegen können Zutaten auch addiert oder abgezogen werden – je nachdem, wie der Küchenchef interpretieren will.
Eine Zutat, die im ersten Rezept, jenem vom Sportfest, den Übermittlungen nach nicht dabei war, ist die Kalbsniere, die in späteren Varianten das Kalbfleisch ergänzte, es würziger und rustikaler macht. Die Kalbsniere ist – wie fast alle Innereien – aus den Grundzutaten neuzeitlicher Gastronomie verschwunden, denn trotz der ethischen «Nose-to-Tail-Bewegung», die das ganzheitliche Verwerten geschlachteter Tiere propagiert, finden geschmacksreiche und geschmackseigene Organe kaum noch Anklang bei den Gästen – auch wenn sie als «hip» deklariert werden. Man würzt lieber nach, um Würze zu bekommen.
So verzichtet auch Philippe Schoch in der «Kronenhalle» auf die Niere, was ihm ein bisschen leid tut, denn er wüsste ja, wie man eine Niere so vorbereitet, dass sie ihren Hautgout verliert. Aber die Zeiten sind wie die Zeiten eben sind, und so holt Schoch in der Vorbereitungsküche der «Kronenhalle», die im darunterliegenden Keller untergebracht ist, eine Kalbsnuss aus der Vakuumhülle. Selbstredend ist das Fleisch Schweizer Fleisch, so wie alle anderen Zutaten Schweizer Zutaten sind. Man hat im Land alles, was es braucht.
In der Vorbereitungsküche wird inzwischen die Pilzrahmsauce in grosser Quantität zubereitet; sie wird hier im Laufe des Tages am Köcheln gehalten und für die jeweilige Portion Geschnetzeltes aus dem massiven Stahlbottich geschöpft. Und da ist Butter! Butter satt! Philippe Schoch löffelt eine für Gesundheitsfanatiker angsteinflössende Menge Butter in eine der vom täglichen Gebrauch mit Patina gezeichneten «Kronenhalle»-Pfannen. Hier ist man stolz auf das alte Gusseisen, das alte Kupfer und das alte Silber, das teils schon Jahrzehnte in Gebrauch ist und die kulinarische Tradition manifestiert.
Die «Kronenhalle» und die «Kronenhalle Bar» wurden 1924 von der Familie Zumsteg eröffnet; der Sohn Gustav Zumsteg war es, der die «Kronenhalle» in den 50er- und 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts berühmt machte, denn seine legendäre Kunstleidenschaft liess Maler, Regisseure und Schauspieler einkehren, die für Mundpropaganda sorgten. Zumsteg starb 2005 und seither ist die «Kronenhalle» im Besitz einer Stiftung, die dafür sorgt, dass gottlob keine kulinarische Moderne einzieht. Das Besondere der «Kronenhalle»: Man sitzt an manchen Tischen unter Originalwerken von Miró, Chagall, Picasso und anderen Giganten der bildenden Kunst. Dafür ist man gerne gewillt, auch etwas mehr Franken hierzulassen, denn die «Kronenhalle» ist, wie fast alle legendären Restaurants, kein günstiges Lokal.
Viel Butter ist Pflicht
Philippe Schoch schneidet das Fleisch gegen die Faser in dünne Streifen; man merkt: Er hat dies schon tausende Male getan. In die Pfanne kommt keine Zwiebel – auch das eine Interpretation –, in der Butter wird das Fleisch schnell braun. Flugs ist es heraus und wartet auf die von einem anderen Koch zubereitete Rösti – auch hier ist viel Butter Pflicht. Ein weiterer Koch schwingt den Schöpflöffel der Champignonrahmsauce, der über dem Fleisch sein Ziel findet, das in einem alten Silbergefäss auf die Vollendung wartet. Die Rösti landet auf einem ebenfalls fein verbeulten Silberteller. So kommt das Ganze zu Tisch, wo es dann auf signiertem Porzellan für den Gast hergerichtet wird. Eine Portion reicht für zwei Gänge; der Nachschub wartet, im Rechaud warm gehalten, bis ihn der Gast beim Kellner abruft.
Diese Prozedur geschieht für uns vor dem Mittagsservice. Im Bereich der Schank sitzen nun alle Mitarbeiter bei einem vorzüglichen und keineswegs abgespeckten Personalessen, lesen Zeitung oder Nachrichten am Smartphone und warten, bis der Trubel beginnt. Hier ist man sich in allem sicher, was man tut; man weiss, wo man es tut und was der Ort bedeutet. So möge es bitte noch viele Jahre bleiben.